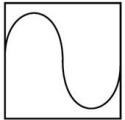Empfohlene Zitierweise: Ferdinand Hundt und Jean-Gaspard Callion
Das Prinzip künstlerischer Arbeitsweise im Barock: "daß aus tausend guten ein neues Besseres sich schaffen lassen müsse...".
...
Sowohl Balthasar Neumann als auch Friedrich Carl von Schönborn gingen im August des Jahres 1740 in ihren Äußerungen auf die Modelle Ferdinand Hundts ein, die "auf neier andere arth mögten ahn befohlen werdten" bzw. "in welchem gusto" angefertigt werden sollten. Diese Formulierungen in den Quellen lassen auf einen Stilwechsel bereits zu diesem Zeitpunkt schließen. ... In der Zeit, in der Hundt sich mit Vorarbeiten für das Parade-Audienzzimmer beschäftigte und die Modelle anfertigte, ereignete sich ein Vorfall, der sowohl die städtischen Behörden als auch die der fürstlichen Regierung beschäftigte. Aus den Ratsprotokollen vom 30. August 1740 geht hervor, dass Ferdinand Hundt mehr als 5 Wochen lang einen "beweibten bildthawer aus frankreich" bei sich beherbergt hatte, und dies, ohne die Behörden davon in Kenntnis gesetzt oder um Erlaubnis gebeten zu haben. Hundt war für diesen Verstoß mit einer Geldbuße von 2 fl. bestraft worden, die er entweder ... . Dem fremden Bildhauer, der bei Ferdinand Hundt gewohnt hatte, wurde durch den Stadtrat ein längerer Aufenthalt in Würzburg verweigert. Als sich daraufhin Hofkammerrat Rossath für einen längeren Verbleib des Bildhauers einsetzte, kam es zu einem Protest des Schreinermeisters Frdinand Hundt und des Bildhauers Georg Guthmann. Beide fürchteten offensichtlich die Konkurrenz des französischen Bildhauers, dessen Leistungen sie in der Verhandlung vor dem Rat herabwürdigten. ... Da sowohl Hundt als auch Guthmann kein Interesse daran haben konnten, dass Callion eine Beschäftigung bei Hofe erhalten würde, sind deren abschätzige Bemerkungen, die Reputation des Bildhauers betreffend, entsprechend zu bewerten.
Ein kurzer Blick auf die weitere Tätigkeit Callions mag einen Eindruck von den Fähigkeiten des französischen Bildhauers geben.
...
Es liegt aufgrund des Stilwandels im Sommer 1740, just zu dem Zeitpunkt, als Callion in Würzburg weilte, die Vermutung nahe, dass Callion der Vermittler entscheidender neuer Impulse für den Durchbruch des Rokoko-Ornaments in Würzburg war. Wie im Folgenden gezeigt weren soll, war es jedoch das Verdienst des Kunstschreiners Ferdinand Hundt, die Impulse aufgenommen und weiterentwickelt zu haben. In: Verena Friedrich, Rokoko in der Residenz Würzburg. Studien zu Ornament und Dekoration des Rokoko in der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz zu Würzburg. Bayerische Schlösserverwaltung: Forschungen zur Kunst- und Kulturgeschichte Band IX. Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte Würzburg e.V. VIII. Reihe: Quellen und Darstellungen zur fränkischen Kunstgeschichte, Band 15, Würzburg 2004, S.9, 182-184.
Vgl. hierzu:
http://www.sehepunkte.de/2006/01/pdf/7357.pdf
Empfohlene Zitierweise:
Henriette Graf: Rezension von: Verena Friedrich: Rokoko in der Residenz Würzburg.
Studien zu Ornament und Dekoration des Rokoko in der ehemaligen
fürstbischöflichen Residenz zu Würzburg, München: Bayerische Verwaltung der
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen 2004, in: sehepunkte 6 (2006), Nr. 1 [15.01.2006],
http://www.sehepunkte.de/2006/01/pdf/7357.pdf (21.02. 2011)
Ein Beitrag zum Sachverhalt Barock-Rokoko-Aufklärung! Oder: Zurück zu Kant.
...
Sowohl Balthasar Neumann als auch Friedrich Carl von Schönborn gingen im August des Jahres 1740 in ihren Äußerungen auf die Modelle Ferdinand Hundts ein, die "auf neier andere arth mögten ahn befohlen werdten" bzw. "in welchem gusto" angefertigt werden sollten. Diese Formulierungen in den Quellen lassen auf einen Stilwechsel bereits zu diesem Zeitpunkt schließen. ... In der Zeit, in der Hundt sich mit Vorarbeiten für das Parade-Audienzzimmer beschäftigte und die Modelle anfertigte, ereignete sich ein Vorfall, der sowohl die städtischen Behörden als auch die der fürstlichen Regierung beschäftigte. Aus den Ratsprotokollen vom 30. August 1740 geht hervor, dass Ferdinand Hundt mehr als 5 Wochen lang einen "beweibten bildthawer aus frankreich" bei sich beherbergt hatte, und dies, ohne die Behörden davon in Kenntnis gesetzt oder um Erlaubnis gebeten zu haben. Hundt war für diesen Verstoß mit einer Geldbuße von 2 fl. bestraft worden, die er entweder ... . Dem fremden Bildhauer, der bei Ferdinand Hundt gewohnt hatte, wurde durch den Stadtrat ein längerer Aufenthalt in Würzburg verweigert. Als sich daraufhin Hofkammerrat Rossath für einen längeren Verbleib des Bildhauers einsetzte, kam es zu einem Protest des Schreinermeisters Frdinand Hundt und des Bildhauers Georg Guthmann. Beide fürchteten offensichtlich die Konkurrenz des französischen Bildhauers, dessen Leistungen sie in der Verhandlung vor dem Rat herabwürdigten. ... Da sowohl Hundt als auch Guthmann kein Interesse daran haben konnten, dass Callion eine Beschäftigung bei Hofe erhalten würde, sind deren abschätzige Bemerkungen, die Reputation des Bildhauers betreffend, entsprechend zu bewerten.
Ein kurzer Blick auf die weitere Tätigkeit Callions mag einen Eindruck von den Fähigkeiten des französischen Bildhauers geben.
...
Es liegt aufgrund des Stilwandels im Sommer 1740, just zu dem Zeitpunkt, als Callion in Würzburg weilte, die Vermutung nahe, dass Callion der Vermittler entscheidender neuer Impulse für den Durchbruch des Rokoko-Ornaments in Würzburg war. Wie im Folgenden gezeigt weren soll, war es jedoch das Verdienst des Kunstschreiners Ferdinand Hundt, die Impulse aufgenommen und weiterentwickelt zu haben. In: Verena Friedrich, Rokoko in der Residenz Würzburg. Studien zu Ornament und Dekoration des Rokoko in der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz zu Würzburg. Bayerische Schlösserverwaltung: Forschungen zur Kunst- und Kulturgeschichte Band IX. Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte Würzburg e.V. VIII. Reihe: Quellen und Darstellungen zur fränkischen Kunstgeschichte, Band 15, Würzburg 2004, S.9, 182-184.
Vgl. hierzu:
http://www.sehepunkte.de/2006/01/pdf/7357.pdf
Empfohlene Zitierweise:
Henriette Graf: Rezension von: Verena Friedrich: Rokoko in der Residenz Würzburg.
Studien zu Ornament und Dekoration des Rokoko in der ehemaligen
fürstbischöflichen Residenz zu Würzburg, München: Bayerische Verwaltung der
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen 2004, in: sehepunkte 6 (2006), Nr. 1 [15.01.2006],
http://www.sehepunkte.de/2006/01/pdf/7357.pdf (21.02. 2011)
Ein Beitrag zum Sachverhalt Barock-Rokoko-Aufklärung! Oder: Zurück zu Kant.
MfMKMuenchen - 21. Feb, 12:59